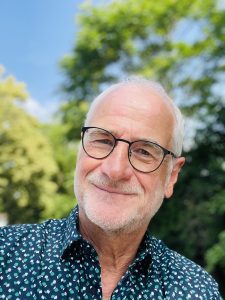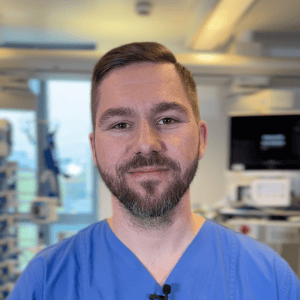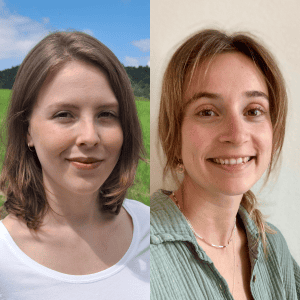On-Demand-Angebot
Vorträge zum Schwerpunkt „Palliative Care“
Fachvortrag
Leben in Würde! – Sterben in Würde?
Die Herausforderung mit selbstverwahrlosten Menschen in der ambulanten Palliativversorgung.
Offener Vortrag
Zuversicht am Lebensende.
Aus dem Blickwinkel der Palliativversorgung.
Fachvortrag
Wenn wahr wird, was nicht wahr sein darf…
Ethikberatung im interkulturellen Kontext.
Fachvortrag
Wie gerecht ist Sterben?
Was uns das Lebensende über soziale Gerechtigkeit verrät.
Fachvortrag
Im Tod sind alle gleich?
Vom professionellen Umgang mit kleinen Unterschieden, die einen großen Unterschied machen.
Fachvortrag
Essen ... ist Vielfalt.
"Der Mensch ist, was er isst." (Feuerbach)
Fachvortrag
Zugang zu Palliativversorgung von muslimischen Eingewanderten.
Same, same but different?
Fachvortrag
Fachvortrag
Nichts gibt Halt.
Eine palliativseelsorgliche Provokation.
Fachvortrag
Hoffnung in der Palliative Care – wo berührt unser Handeln die Dimension Hoffnung?
Ein Vortrag aus pflegerischer Sicht.
Fachvortrag
Sterben auf der Intensivstation.
Zwischen Maschinen, Geräten und einer abstrakten Umgebung gibt es auch Menschlichkeit.
Fachvortrag
Moral Distress in der Palliative Care bewältigen – Strategien zur Stärkung moralischer Resilienz.
Wie Pflegefachpersonen ihre moralische Integrität schützen können.